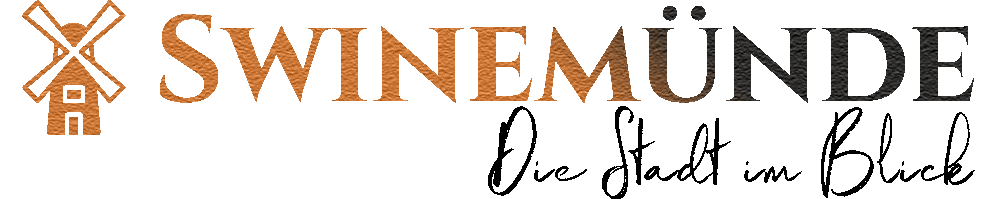Deutsch
Die Stadt Swinemünde
Swinemünde/ Swinoujście (PL) ist mit etwa 40.000 Einwohnern die größte Stadt auf der Insel Usedom. Neben Misdroy (Międzyzdroje), Kolberg (Kołobrzeg) und Zoppot (Sopot) ist Swinemünde (Świnoujście) eines der bekanntesten polnischen Ostseebäder. Stadtteile sind Swinemünde (Świnoujście), Kaseburg (Karsibór), Werder (Ognica), Pritter (Przytór), Haferhorst (Łunowo), Friedrichsthal (Wydrzany), Ostswine (Warszów) und Osternothafen (Chorzelin). Vom Stadtteil Ostswine (Warszów auf Wollin) aus bestehen Fährverbindungen der Unity Line nach Ystad und der TT-Line nach Trelleborg in Schweden.
Das Ostseebad S. hat einen herrlichen breiten Strand und eine sehr schöne Umgebung. Die Nähe zu Misdroy, Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin ermöglicht Ausflüge in diese Bäder. Im Jahre 2023 wurde die Swine untertunnelt. Die Inseln Usedom und Wollin sind nun durch einen 1,8 Kilometer langen Autotunnel verbunden, die Autofähren haben ausgedient. Heringsdorf, Swinemünde und Misdroy (auf Wollin) wurden auf diese Weise zu Nachbarorten, die schnell zu erreichen sind. Kureinrichtungen, Hotels und Pensionen beider Länder erwarten in diesen Orten ihre Gäste.
Swinemünde war im 18.Jahrhundert an der Swinemündung (in der Nähe des Dorfes Swina) als preußische Hafenstadt entstanden. Als bedeutendstes deutsches Ostseebad konnte sich Swinemünde bis in die vierziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit voller Berechtigung "Weltbad" nennen. Im Jahr 1945 wurde die Stadt polnisch. Die deutschen Einwohner hatten die Stadt verlassen müssen.
Heute profitieren die Stadt und ihre Wirtschaft zunehmend von ihrer Nähe zu Deutschland. Die zahlreichen deutschen Besucher und Gäste sind für die Swinemünder Hotels, Pensionen, Gaststätten und Märkte und sogar für die Tankstellen von existenzieller Bedeutung. Auf der deutschen Seite der Grenze ist ebenfalls eine gewisse Abhängigkeit entstanden: In den Hotels und Pensionen von Heringsdorf sind die fleißigen polnischen Köche, Serviererinnen und Reinigungskräfte unverzichtbar.
Wie in deutschen Zeiten in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts ist die Stadt heute wiederum eine Boomtown. Im Stadtzentrum sind zahlreiche Wohnhäuser entstanden, an der östlichen Promenade reihen sich neue Hotels und Pensionen in große Zahl aneinander. Und auch die Wirtschaft boomt.
Im Jahre 2010 begann man in S. mit dem Projekt Gazoport, um große Mengen verflüssigtes Erdgas aus Katar und Algerien importieren zu können. Ein neuer Hafen für die Tanker und sehr große Speicher für das Gas wurden in relativ kurzer Zeit fertiggestellt. Und schließlich: Geplant ist ein recht großer Containerhafen auf der Insel Wollin, gegen den sich auf deutscher Seite Widerstand regt.